Am Abend des 4. Juli 1945, heute vor 80 Jahren, strömten 1.500 Gäste, die meisten davon Schriftsteller*innen und Künstler*innen, in den großen Sendesaal im Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee. Eingeladen hatte der „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“ zu seiner Gründungsveranstaltung.
Die Rede von der demokratischen Erneuerung
Johannes R. Becher, der erst kürzlich aus dem Moskauer Exil zurückgekehrte Schriftsteller, ergriff das Wort und hielt eine flammende Rede:
„Alle Deutschen, die guten Willens sind, beschwören wir: Es werde Licht! Lasst endlich, endlich ein freiheitliches, wahrhaft demokratisches Deutschland auferstehen!“
Für die Gäste, die teilweise stundenlange Fußmärsche durch das zerstörte Berlin in Kauf genommen hatten, um ins Haus des Rundfunks in Charlottenburg zu gelangen, klang das wie eine Verheißung nach zwölf Jahren Diktatur. Viele von ihnen waren wie Becher selbst erst kurz zuvor aus dem Exil zurückgekommen. Andere, wie Bernhard Kellermann, der an diesem Abend ebenfalls eine Rede hielt, waren in Deutschland geblieben, obwohl ihre Bücher als „entartet“ verbrannt und verboten worden waren.
Begeistert vom kulturellen Neuanfang
Der Abend wurde ein voller Erfolg, nicht nur in Berlin. Überall gründeten sich Ortsgruppen, die sich für einen demokratischen, kulturellen Neuanfang einsetzen wollten. In Schwerin waren es z.B. in kürzester Zeit 5.800 Mitglieder, die kulturelle Veranstaltungen aller Art organisierten. Das Besondere war auch, dass die Kulturbundarbeit in allen Besatzungszonen stattfinden sollte und tatsächlich auch stattfand, zumindest bis zum Herbst 1947. Dann nämlich verboten Amerikaner und Briten den Kulturbund in ihren Zonen, weil sie ihn als kommunistische Agitationsplattform betrachteten. Wie konnte es dazu kommen?
Pläne in Moskau
Gehen wir noch einmal zurück vor die Gründungsveranstaltung am 4. Juli. Schon im sowjetischen Exil in Moskau arbeitete Johannes R. Becher an Plänen für ein Bündnis von Intellektuellen und Künstler*innen, um den kulturellen und geistigen Wiederaufbau Deutschlands voranzutreiben. Darin wurde er von Anfang an von der Sowjetunion unterstützt und gleichzeitig kontrolliert.
Ein Offizier ist dabei
Ende Juni 1945 lud Johannes R. Becher Interessierte verschiedener politischer Richtungen zu einem Treffen in Berlin ein, um die Gründungsveranstaltung vorzubereiten. Die deutschen Intellektuellen waren aber nicht unter sich. Ein Offizier der sowjetischen Besatzungsmacht saß mit am Tisch und machte sich eifrig Notizen.
Unter sowjetischer Kontrolle
Dass die Gründungsveranstaltung im Haus des Rundfunks stattfand, war auch kein Zufall. Zwar liegt die Masurenallee in Charlottenburg und damit im britischen Sektor Berlins, aber das Haus des Rundfunks war im Juli 1945 noch fest in sowjetischer Hand.
Zunächst pluralistisch
Trotz der Kontrolle durch die sowjetische Besatzungsmacht entwickelte sich der Kulturbund zunächst zu einer pluralistischen, parteiübergreifenden Sammlungsbewegung für Intellektuelle und Künstler*innen. In der Monatszeitschrift „Aufbau“, die Johannes R. Becher als erster Präsident des Kulturbundes schnell gründete, konnte man zu verschiedenen Themen die unterschiedlichsten Meinungen lesen. Den „streitbaren Demokratismus“, den sich Becher auf die Fahnen geschrieben hatte und auch in seiner Rede am 4. Juli propagierte, schien er tatsächlich ernst zu meinen.
Die Führungsrolle der SED
Mit der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) durch die Zwangsvereinigung von KPD und SPD in der sowjetischen Zone im April 1946 wurde dieser Kurs zunehmend schwieriger. Die SED duldete keinen autonomen und pluralen Kulturbund neben sich, sondern versuchte massiv, auf die Kulturarbeit einzuwirken, auch die Zeitschrift „Aufbau“ wurde immer stärker zensiert.
Die Umerziehung im Geiste des Sozialismus stand immer mehr im Vordergrund der Kulturarbeit. Dies wollten Briten und Amerikaner für ihre Besatzungszonen unbedingt vermeiden und verboten deshalb den „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“ 1947 in den Westzonen.
Auf dem Weg zur Massenorganisation
Ab der Staatsgründung der DDR im Oktober 1949 öffnete sich der Kulturbund für Vereine von Briefmarkensammlern oder Heimatpflegern, die auf Subventionen hofften. Dadurch stiegen die Mitgliederzahlen in die Höhe, obwohl gleichzeitig viele Kulturschaffende den Kulturbund verließen, weil sie mit dem von der SED dominierten Kurs nicht einverstanden waren.
In der DDR wurde der Kulturbund zur Massenorganisation für kulturelle Freizeitaktivitäten mit über 280.000 Mitgliedern und ein Transmissionsriemen für die Kulturpolitik der SED. Mit Demokratie und Pluralismus hatte das nicht mehr viel zu tun. 1958 strich man die „demokratische Erneuerung“ aus dem Titel und nannte ihn „Deutscher Kulturbund“, ab 1974 dann „Kulturbund der DDR“.


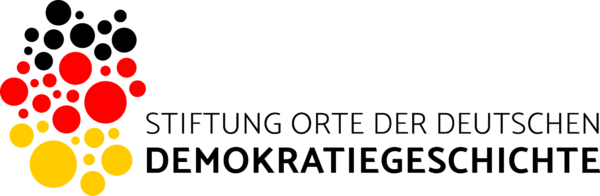

0 Kommentare