Heute vor 24 Jahren, am 29. August 2001, wurde der damals 38-jährige Habil Kılıç durch den Nationalsozialistischen Untergrund ermordet. Diese Tat reihte sich ein in eine rassistisch motivierte Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe.
Entstehungsgeschichte des NSU
Seine Ursprünge fand der selbsternannte Nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, in den 1990er Jahren. Während rechtsextreme Anschläge deutschlandweit immer mehr zunahmen, schlossen sich auch Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos der rechtsextremen Szene in Jena an. Gemeinsam mit weiteren Neonazis gründeten sie die „Kameradschaft Jena“. Sie verbreiteten antisemitische Propaganda und bauten Bombenattrappen, die sie im Anschluss verschickten.
Im Zuge dieser Anschläge durchsuchten Polizist*innen im Januar 1998 eine Garage, in der sie Rohrbomben, Sprengstoff und Propagandamaterial fanden. Anschließend tauchten Mundlos, Bönhardt und Zschäpe, die die Garage zum Bombenbau nutzten, unter. So gründete sich der NSU, unterstützt von Netzwerken, die sich das Trio vorher in der rechtsextremen Szene erschlossen hatte. Die darauffolgenden Jahre waren geprägt von Raubüberfällen und rassistischen Anschlägen – bis hin zu Morden.
Zehn Mordanschläge – davon neun rassistisch motiviert
Die Mordserie des NSU begann im September 2000, als der Blumenhändler Enver Şimşek in Nürnberg ermordet wurde. Im Juni 2001 erschoss der NSU dann Abdurrahim Özüdoğru und Süleyman Taşköprü. Habil Kılıç war das vierte Mordopfer der Terrorgruppe. Aber auch nach seinem Tod forderten mangelhafte Ermittlungen der Behörden weitere Opfer durch den NSU.
Im Februar 2004 wurde Mehmet Turgut ermordet, im Juni 2005 Ismail Yaşar und Theodoros Boulgarides. Ein Jahr später, im April 2006, erschoss der NSU Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat. Der letzte heute bekannte Mord durch den NSU geschah im April 2007 an der Polizistin Michèle Kiesewetter. Alle neun Opfer vor ihr waren Menschen mit Migrationsgeschichte, oftmals Kleinunternehmer und Familienväter. Diese Morde waren also eindeutig rassistisch motiviert.
Stigmatisierende Ermittlungen
Ab dem zweiten Mord an Abdurrahim Özüdoğru war den Behörden klar, dass es eine Verbindung zwischen den Mordanschlägen geben muss. Denn alle rassistisch motivierten Anschläge waren mit derselben Tatwaffe verübt worden. Doch anstatt einem rechtsextremen Motiv nachzugehen, liefen die Ermittlungen jahrelang in die falsche Richtung. Es war von organisierter Kriminalität die Rede, von Drogen, Prostitution und Glücksspiel.
Ohne sich auf Beweise stützen zu können, gingen die Ermittler*innen von Verbindungen zur PKK oder den Grauen Wölfen aus. Sie reisten sogar bis in die Türkei, um dort Angehörige zu befragen. Aber auch die Verwandten in Deutschland befragte die Polizei, sie durchsuchte deren Wohnungen und zerstörte dabei Möbel. Sie sah also eine Mitschuld bei Opfern und Hinterbliebenen. Dasselbe Bild reproduzierten die Medien. Man sprach abwertend von „Dönermorden“ und erwog keine Zusammenhänge zur rechtsextremen Szene.
Alleingelassene Hinterbliebene
Diese allgemeine abwertende Haltung spiegelte sich auch im Umgang mit den Hinterbliebenen wider. So musste Pinar Kiliç den Tatort, an dem ihr Mann Habil Kiliç starb, selbst reinigen, weil die Polizei keinen Tatortreiniger beauftragte. Auch ihre gemeinsame damals 12-jährige Tochter erlebte Stigmatisierungen. Anstatt von der Schule Unterstützung zu erhalten, wurde sie der Schule verwiesen. Man sah in der Tochter ein „Sicherheitsrisiko“. Andere hinterbliebene Familien, wie beispielsweise Enver Şimşeks Frau Adile Şimşek, vermuteten schon direkt nach dem Mord ein rechtsextremes Motiv. Doch die Ermittler*innen schenkten diesen Hinweisen kein Gehör.
Enttarnung des NSU
Erst als der NSU sich im November 2011, elf Jahre nach dem ersten Mord, selbst enttarnte, wurden die Taten in Zusammenhang mit Rechtsextremismus gebracht. Nachdem Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt nach einem Banküberfall beinahe aufflogen, töteten sie sich selbst und setzten das Wohnmobil, in das sie geflüchtet waren, in Brand.
Daraufhin zündete Beate Zschäpe ihre gemeinsame Wohnung in Zwickau an und stellte sich ein paar Tage später der Polizei. Diese fand im abgebrannten Wohnhaus ein Bekennervideo der drei Kernmitglieder zu allen zehn Morden. Was Angehörige der Opfer schon jahrelang vermutet hatten, war damit bestätigt.
Behördenversagen
Die Selbstenttarnung des NSU warf einige Fragen zum Versagen von Polizei- und Verfassungsschutzbehörden auf. Sie stigmatisierten die Opfer und beriefen sich in Ermittlungen auf Vorurteile anstatt auf Beweise. Hinweisen auf rechtsterroristische Ursprünge der Taten gingen sie nicht nach. So erhielt das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz von Informanten, sogenannten V-Leuten, mehrfach Hinweise auf den Standort des 1998 untergetauchten Trios. Dennoch wurden Mundlos, Bönhardt und Zschäpe nicht verhaftet.
Einige der V-Leute, die die Verfassungsschutzbehörden bezahlten, waren außerdem fester Bestandteil neonazistischer Netzwerke und bauten diese mit auf. Selbst Mitarbeitende der Verfassungsschutzbehörden gerieten in Verdacht, den NSU mit vertuscht zu haben. Beispielsweise schredderte ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz kurz nach der Enttarnung des NSU wichtige Akten. Sie sollten „die rechtsextremistische Szene in Thüringen […] untersuchen“. Andreas T., ein weiterer Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, war zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Yozgat am Tatort. Er will aber nichts von der Tat mitbekommen haben.
NSU-Prozess
Der Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex widmete sich der Strafprozess, der im Jahr 2013 begann, jedoch kaum. Angeklagt waren Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte, die das Trio unterstützten. Im Juli 2018 verurteilte das Oberlandesgericht München Zschäpe wegen zehnfachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe, während die vier Mitangeklagten zwei, zweieinhalb, drei und zehn Jahre Haftstrafe erhielten. Der Prozess wurde allerdings kritisiert. Er vermittelte das Bild, dass der NSU nur aus Mundlos, Zschäpe und Bönhardt bestand und von lediglich drei weiteren Neonazis unterstützt wurde. In Wirklichkeit war es aber ein ganzes Netzwerk, das dahinter stand.
Untersuchungsausschüsse
Das ergaben auch die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungsausschüsse von Bund und Ländern. Sie rekonstruierten die Taten und benannten Fehlverhalten der Strafverfolgungsbehörden. Obwohl die insgesamt 15 Untersuchungsausschüsse wertvolle Informationen zusammentrugen, bleiben bis heute einige Fragen ungeklärt.
Wie groß das Netzwerk von Unterstützer*innen tatsächlich war, wie viel Verfassungsschutzbehördern wirklich vom NSU wussten und ob sie und die von ihnen bezahlten V-Leute eine aktive Rolle im Verheimlichen der Terrorgruppe gespielt haben – all das sind Fragen, die bis heute unzureichend aufgeklärt sind. Dazu sagte auch Kerim
Şimşek, Sohn des ersten Mordopfers Enver Şimşek: „Ich kann nicht abschließen. Weil ich das Gefühl habe, dass nicht alles dafür getan wurde, um alles aufzuklären.“


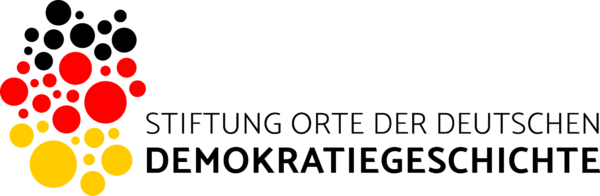

0 Kommentare