Heute vor 50 Jahren, am 1. August 1975, unterzeichneten höchste Repräsentanten aus 35 Teilnehmerstaaten in Helsinki die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa., kurz KSZE-Schlussakte genannt. Was hat es damit auf sich und worauf einigte man sich?
Eine Konferenz beginnt
Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa begann ihre Arbeit in Helsinki bereits am 3. Juli 1973. Ziel war es , ein multinationales Forum für Verhandlungen und Gespräche zwischen Ost und West zu schaffen, um der Gefahr zu begegnen, dass aus dem Kalten Krieg ein heißer Dritter Weltkrieg mit Atomwaffeneinsatz werden könnte. Alle europäischen Staaten (außer Albanien) sowie die Sowjetunion, die USA und Kanada nahmen an der Konferenz teil.
Keine ganz neue Idee
Die Idee einer solchen Konferenz war nicht ganz neu, schon in den 1960er Jahren hatte es Vorschläge dazu von Seiten der Warschauer-Pakt-Staaten gegeben, die der Westen aber immer abgelehnt hatte, weil er befürchtete, die Teilung Deutschlands damit zu zementieren.
Neue Ostpolitik
Bis 1973 hatte sich aber im geteilten Deutschland einiges getan. Willy Brandt, seit 1969 Kanzler, leitete die Neue Ostpolitik ein, um die Beziehung der Bundesrepublik zur DDR und zu anderen Ostblockstaaten zu entspannen. Der Moskauer und der Warschauer Vertrag erklärten die nach 1945 entstandenen Grenzen im Osten für unverletzlich. Im Viermächte-Abkommen zwischen den USA, Großbritannien. Russland und Frankreich 1971 wurde der Status von Berlin und im Grundlagenvertrag 1972 das Verhältnis der beiden deutschen Staaten geklärt.
Weg geebnet
Mit diesen Entwicklungen in Deutschland war der Weg frei für den Konferenzbeginn in Helsinki. Nach fast zweijährigen Verhandlungen wurde am 1. August 1975 die KSZE-Schlussakte von 35 Staaten unterzeichnet.
Festlegungen
Die Staaten vereinbarten in Helsinki Gewaltverzicht, die Achtung von Menschenrechten und die Unverletzlichkeit der Grenzen. Außerdem ebnete die Konferenz den Weg zu einer vertieften Zusammenarbeit in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und im Umweltschutz.
Die Schlussakte als Anfang
In der Folgezeit etablierte sich die KSZE als zwischenstaatliches Beratungsgremium. Die in der Schlussakte festgelegten Ziele konnten allerdings lange Zeit nicht verwirklicht werden. Besonders die Menschenrechte wurden in den Ostblockstaaten auch nach 1975 immer wieder missachtet und verletzt. Dies änderte sich erst mit der von Michail Gorbatschow eingeleiteten Politik von Glasnost und Perestroika.
Von der KSZE zur OSZE
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die KSZE 1995 zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und existiert bis heute als ständige Staatenkonferenz zur Friedenssicherung. Leider gelingt dies nicht in jedem Fall, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt.
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte vor 50 Jahren zum Thema der neuesten Ausgabe der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ gemacht. Die Ausgabe kann auch online gelesen werden.


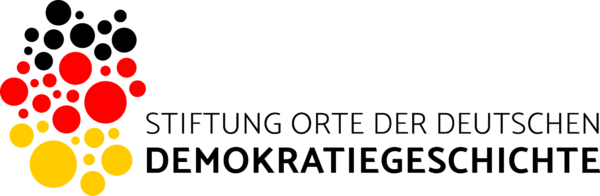

0 Kommentare