Am heutigen 7. Oktober im Jahr 1938 entstand aus dem Rosenkranzfest in Wien eine Demonstration, in der Tausende katholische Jugendliche und junge Erwachsene ihre Treue zur Kirche statt zum NS-Regime öffentlich kundtaten.
Nationalsozialismus und die katholische Kirche
Obwohl die katholische Kirche im Gegensatz zu politischen Parteien nicht verboten wurde und deren Ideologien sich an vielen Stellen mit denen der Nationalsozialisten vereinbaren ließen, war das Verhältnis der katholischen Kirche und des NS-Staates dennoch auch von Konflikten geprägt.
Allerdings basierten diese primär auf den Bemühungen der katholischen Kirche, die ihnen im Reichskonkordat von 1933 zugesicherten institutionellen Sonderrechte zu schützen, welche immer wieder von der NS-Regierung gebrochen wurden. Vor allem die ab 1935/36 umgesetzte nationalsozialistische Religionspolitik der „Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens“ bereitete der katholischen Kirche große Schwierigkeiten. Sie verloren viele Mitglieder, besonders in ihren Jugendorganisationen. Vereine wurde verboten und der schulische Religionsunterricht eingeschränkt. In kirchlichen Protesten prangerte man dies an und kritisierte auch weitere Aspekte der NS-Herrschaft wie beispielsweise den Führerkult. Ein Protest, der die vermehrte Verhaftung und Diffamierung von Geistlichen zur Folge hatte.
Tatsächlicher Widerstand aus christlichen Kreisen gegen die Verbrechen des NS-Regimes, wie die Judenverfolgung und die „Euthanasie“-Maßnahmen, lässt sich jedoch eher als eine Reihe von Ausnahmefällen einordnen, die von Einzelpersonen initiiert wurden. Dazu gehören in der katholischen Kirche beispielsweise Clemens August Graf von Galen, Bernhard Lichtenberg und Gertrud Luckner.
Die Situation in Österreich
Im nach dem 13. März 1938 als Teil des Deutschen Reichs angeschlossenen Österreich sah das Verhältnis von katholischer Kirche und NS-Staat vergleichbar aus. Die Einschränkung der kirchlichen Vereine, Organisationen und Angebote wurde hier innerhalb nach der Angliederung schnell durchgesetzt.
Der endgültige Bruch und der darauf folgende Ausschluss der Kirche aus dem öffentlichen Leben sowie die Verfolgung von Geistlichen sollen in Österreich durch das Rosenkranzfest beziehungsweise die Rosenkranz-Demonstration ausgelöst worden sein.
Von Rosenkranzfest zu Rosenkranz-Demonstration
Anlässlich des Rosenkranzfestes versammelten sich am 7. Oktober 1938 schätzungsweise mehr als 7.000 überwiegend junge Katholik*innen im Stephansdom in Wien. Zu dieser jährlichen Rosenkranz-Andacht hatte der Erzbischof von Wien, Kardinal Theodor Innitzer, eingeladen.

Innitzer, der zuvor unter dem Druck der Nationalsozialisten eher eine Mitläuferrolle eingenommen hatte, zeigte in seiner Andacht einen Kurswechsel. Ausgelöst wurde dieser vermutlich durch die wachsenden Repressalien der NS-Regierung, zu denen auch die Auflösung der Jugendorganisationen der katholischen Kirche in Österreich gehörte. Durch Aussagen wie: „Meine liebe katholische Jugend Wiens, wir wollen gerade jetzt in dieser Zeit umso fester und standhafter unseren Glauben bekennen, uns zu Christus bekennen, unserem Führer, unserem König und zu seiner Kirche […]“ übte er in seiner Andacht implizit, aber klar erkennbar, Regimekritik. Vor allem an der Einschränkung der kirchlichen Rechte, aber auch dem Führerkult.
Im Anschluss an die Predigt versammelten sich viele der jungen Menschen auf dem Vorplatz des Stephansdoms. Statt nach Haus zu gehen, sangen sie gemeinsam Kirchenlieder und es entstand eine spontane Jugenddemonstration. Auch verbreitete NS-Propagandasprüche wandelte man provokant ab, beispielsweise zu ‚Ein Volk, ein Reich, ein Bischof‘ oder ‚Wir wollen unsern Bischof sehen‘. So begleiteten die Demonstrierenden den Erzbischof zu seinem Palais.
Folgen des Protests
Am 7. Oktober selbst kam es bereits zu einzelnen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den katholischen Jugendlichen und Mitgliedern der Hitlerjugend. Diese hatten sich ebenfalls vor dem Dom versammelt. Zudem wurde die Versammlung von Polizei und Gestapo aufgelöst und einzelne Teilnehmende wurden verhaftet. Doch die eigentliche Antwort der Nationalsozialisten auf den Protest und die Provokation von Kardinal Innitzer und der katholischen Jugend erfolgte erst in den Tagen darauf.
Am Abend des 8. Oktober stürmten und verwüsteten HJ-Mitglieder das Erzbischöfliche Palais und verletzten anwesende Geistliche, wie den Domkurat Johannes Krawarik.

Invisigoth67, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
In der Woche darauf, am 13. Oktober 1938, wurde von den Nationalsozialisten als Reaktion auf die Rosenkranz-Demonstration ein Gegenprotest und eine Kundgebung organisiert. Der „Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“, Josef Bürckel, hielt dort eine Rede, in der er den Kardinal als Verräter an Hitler und dem Deutschen Reich darstellte. Die aufgestachelten Nationalsozialisten zogen anschließend am Palais vorbei mit Drohrufen und Bannern, die sich ebenfalls vor allem gegen Innitzer richteten.
Kardinal Theodor Innitzers Rosenkranz-Andacht, aber auch die vergleichbare Predigt des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen, etwa drei Jahre später, am 3. August 1941, prägen heute das Bild kirchlichen Protests im Nationalsozialismus mit.
Rosenkranzfest 1938: Sternstunde des Widerstands – DiePresse.com
Rosenkranzfest 1938: "Euer Führer ist Christus"
Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat im nationalsozialistischen Deutschland | Themen | bpb.de
LeMO Zeitstrahl - NS-Regime - Innenpolitik - Kirchen im NS-Regime


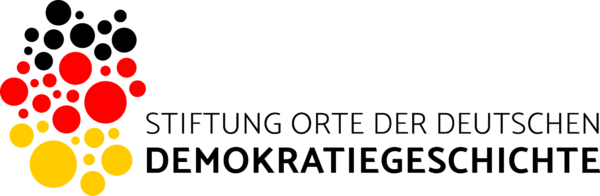

0 Kommentare