In ihrem Beitrag „Gendern und Demokratie“ vom 22. Juli 2022 hat die Autorin Annalena B. auf diesem Blog die Thesen vertreten, dass erstens die deutsche Sprache von sich aus nicht „geschlechtergerecht“ und zweitens eine gerechte Sprache nötig sei, um eine gerechte Welt zu schaffen. Als Beleg weist sie auf eine Reihe von Studien hin, die angeblich zeigten, dass „sich die meisten Menschen bei Formulierungen, die das generische Maskulinum benutzen, vor allem Männer vorstellen.“
Ich teile diese Auffassung nicht. Es gibt keinen manifesten Zusammenhang zwischen dem Genussystem einer Sprache und der jeweiligen gesellschaftlichen Rolle von Frauen und Diversen. Daher ist aus meiner Sicht überaus fraglich, ob die Gendersprache mehr als einen symbolischen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter zu leisten imstande ist. Außerdem erweisen sich die ihr zugrundeliegenden und immer wieder bemühten Assoziationsstudien – wie etwa Fabian Payr und Tobias Kurfer gezeigt haben – bei genauerer Betrachtung als wissenschaftlich wenig überzeugend.
Als Historiker und Mitglied von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ möchte ich mich in diesem Blogbeitrag aber weniger mit der sprachwissenschaftlichen Kontroverse um das Thema befassen als vielmehr die Fragen diskutieren, inwieweit Gendern eigentlich als demokratisch gelten kann und welchen Einfluss die Gendersprache auf unsere pluralistische Debattenkultur ausübt. Der Text schließt mit einem Vorschlag, wie wir die sprachliche Kluft in unserer Gesellschaft überwinden könnten.
Was macht Gendern in manchen Kreisen so attraktiv?
Wenn man sich den Auswirkungen der Gendersprache auf unsere politische Kultur anzunähern versucht, lohnt es sich zunächst einmal der Frage nachzugehen, woraus das Gendern in bestimmten Milieus seine große Attraktivität gewinnt. Aus meiner Sicht sind hierfür drei Gründe ausschlaggebend: Erstens der bloße Zwang, der von Verordnungen etwa in Behörden und Universitäten ausgeht und Studenten eine schlechtere Benotung fürchten lässt, sollten sie in ihren Texten nicht gendern. Zweitens der Konformitätsdruck, den auch nicht verbindliche Sprachleitfäden erzeugen.
Und schließlich drittens die insbesondere in linken bis linksliberalen urbanen Akademikermilieus erwünschte Funktion eines Markers, mit dem der Anwender (oder: die*der Anwender*in) zum Ausdruck bringen kann, dass er die einschlägigen Codes der „Wokeness“ kennt und beherrscht. Gendern ist – ob gewollt oder nicht – immer auch ein performativer Akt mit einer starken sozialen Schlagseite. Ob spätere Sozialhistoriker das Phänomen der Gendersprache einmal mit dem theoretischen Rüstzeug Bourdieus untersuchen und feststellen werden, wie das Gendern Bestandteil eines bildungsbürgerlichen Habitus wurde und der demonstrativen Zurschaustellung von kulturellem Kapital dient?
Ist Gendern demokratisch?
Diese soziale Schlagseite führt unmittelbar zu der Frage, wie demokratisch das Gendern eigentlich ist. Ich würde behaupten: In einem formalen Begriffsverständnis kann Gendern weder demokratisch noch undemokratisch sein. Schließlich ist Sprache nichts, über das in einem Wahlakt abgestimmt wird. Vielmehr verändert sie sich in einem fortlaufenden Prozess unter Beteiligung der gesamten Sprachgemeinschaft. Wenn man als einen Kernbestandteil der pluralistischen Demokratie jedoch das sorgfältige Ausbalancieren zwischen Mehrheitsmeinung und Minderheitsinteressen begreift, lassen sich aus dieser Perspektive zwei gewichtige Einwände gegen das Gendern hervorbringen.
Zum einen ist hier der bekannte Befund zu nennen, dass die Gendersprache in ihren verschiedenen Formen – und ganz besonders in Gestalt des „Gendersterns“ – in Umfragen von einer großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird. Über diese Tatsache in dem Glauben, es besser zu wissen („Die lernen es schon noch!“), einfach hinwegzugehen, wäre Ausdruck paternalistischer Selbstzufriedenheit. So stellt sich durchaus die Frage, mit welcher Legitimation „der Staat“ und die öffentlich-rechtlichen Medien den Bürgern dennoch immer häufiger gendernd gegenübertreten.
Neben diesem Demokratiedefizit des Genderns lässt sich zum anderen ein ebenso erhebliches Inklusionsdefizit ausmachen. So erweist sich die Gendersprache nicht nur gegenüber bildungsfernen Milieus als ausgrenzend. Auch Menschen mit einer Behinderung (z. B. Sehgeschädigten) oder Migranten erschwert sie den Erwerb und Gebrauch der ohnehin schon komplizierten deutschen Sprache. Es kann natürlich nicht darum gehen, die genannten Gruppen gegen sexuelle Minderheiten auszuspielen. Aber ein wenig mehr Bewusstsein für die Exklusionsverluste, die den vermeintlichen Inklusionsgewinnen der Gendersprache gegenüberstehen, wäre durchaus angebracht.
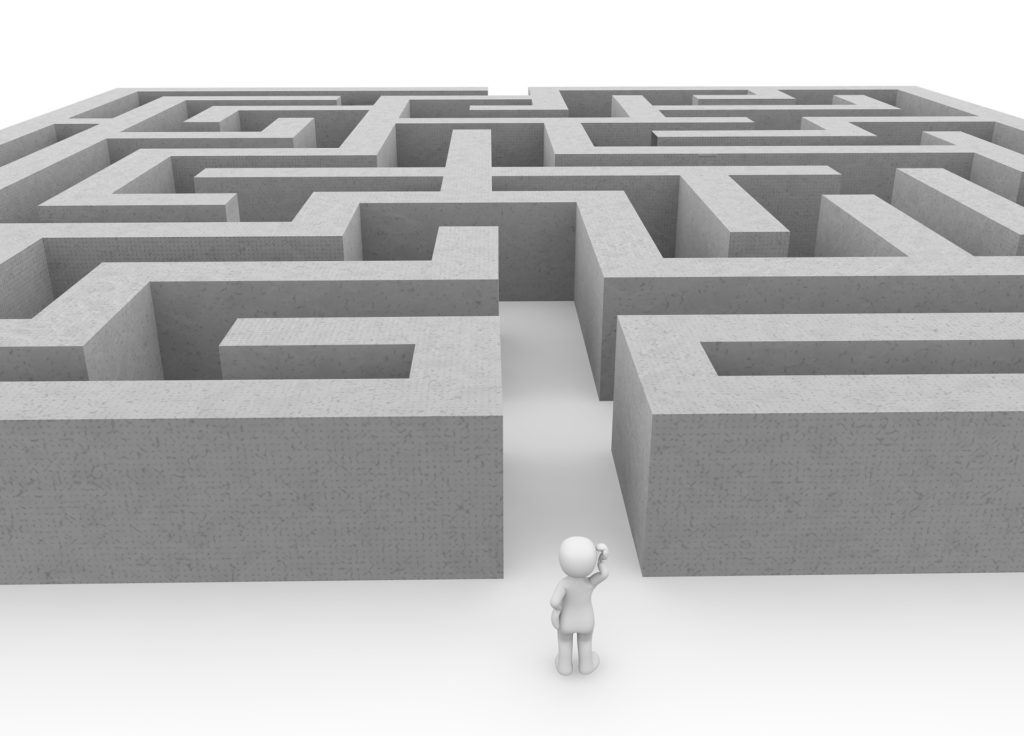
Das fatale Drehen an der Polarisierungsspirale
Annalena B. räumt zu Beginn ihres Beitrags ein, „dass Gendern wohl das am häufigsten negativ kommentierte Thema der Demokratiegeschichten ist.“ Auch der Verfasser dieses Beitrags kann eine gewisse Erregung bei dem Thema nicht leugnen. Warum reagieren die meisten Menschen so emotional, wenn es um das Gendern geht? Der Grund ist wohl in der bereits thematisierten Marker-Funktion des Genderns zu finden. Wer gendert, sendet zugleich immer auch den Subtext, dass der Sprachgebrauch des nicht-gendernden Gegenübers diskriminierend sei – obwohl die These, das generische Maskulinum und damit die deutsche Sprache insgesamt seien nicht „geschlechtergerecht“, auf überaus wackeligen Beinen steht.
Es sind der belehrende Charakter und die demonstrative Zurschaustellung der vermeintlichen eigenen Aufgeklärtheit, die dafür sorgen, dass das Gendern einen nicht unerheblichen Beitrag zu der fortschreitenden Polarisierung in unserer Gesellschaft leistet. Von amerikanischen Verhältnissen, wo „progressive“ Küstenbewohner und Menschen aus Nebraska oder dem Rust Belt nur noch bedingt dieselbe Sprache sprechen, sind wir zum Glück noch weit entfernt. Doch auch bei uns in Deutschland wird zunehmend eine Konstellation erkennbar, in der sich – aus Gründen der Praktikabilität mehr im Schriftverkehr als im Alltagssprachgebrauch – gendernde Akademikermilieus aus den Städten und eine nicht-gendernde Mehrheitsbevölkerung verständnislos gegenüberstehen.
Gendern als Bestätigung populistischer Narrative
Fatalerweise können Populisten in dieser Auseinandersetzung zwischen einer großen ablehnenden Mehrheit und einer laut und vernehmbar gendernden Minderheit in einflussreichen Multiplikatorenpositionen eine greifbare Bestätigung für ihre Weltsicht finden, in der sich „das Volk“ und „die da oben“ klar konturiert gegenüberstehen. Wer gendert, muss sich gewahr sein, dass er solchen antipluralistischen Narrativen Nahrung gibt.
Und in der Tat erinnert diese beharrlich „von oben“ geführte Diskussion mitsamt ihrer paternalistischen Anmaßung, mit Hilfe der Sprache über das Denken anderer Menschen bestimmen zu wollen, eher an die Sprachpolitik in der DDR oder an Orwells „Neusprech“ als an eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaft. Dass das Gendern seinen Vormarsch zurzeit mehr bürokratischen Verordnungen und Leitfäden als der Einsicht in die besseren Argumente verdankt, müsste eigentlich unabhängig vom Ergebnis jeden nachdenklich stimmen, der für einen ergebnisoffenen gesellschaftlichen Diskurs einsteht.

Auf dem Weg zu einer gerechten Sprache?
Kann Sprache überhaupt, wie von Annalena B. behauptet, gerecht sein? Es ist gut und richtig, dass wir auf Begriffe mit einer diskriminierenden Tradition verzichten und sensibel mit unserer Sprache umgehen. Es wäre auch zu begrüßen, wenn sich im allgemeinen Sprachgebrauch Alternativen zum Müllmann oder der Krankenschwester etablieren, die die zugehörigen Berufsbilder nicht mehr eindeutig einem Geschlecht zuweisen.
Aber: Sprache ist an und für sich weder gerecht noch ungerecht. Sie ist das, was der Einzelne aus ihr macht und an Bedeutung in sie hineinlegt. Dies gilt selbst für den „Genderstern“. Auch er ist nur das, was man in ihn hereininterpretiert – je nach Perspektive eine identitätspolitische Kampfansage oder ein zu begrüßendes Symbol für potenziell unbegrenzte geschlechtliche Vielfalt. Worten und Zeichen lässt sich keine feststehende Bedeutung zuweisen. Deshalb ist die Sprache auch ein denkbar ungeeignetes Terrain, um in einer Konzertierten Aktion aus Medien, Universitäten und Teilen der Politik bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen durchzusetzen.
Plädoyer für eine feministische Eroberung des generischen Maskulinums
Daher möchte ich abschließend statt einer Beseitigung für eine „feministische Eroberung“ des generischen Maskulinums plädieren. Ein Vorbild könnte jemand wie Carola Rackete sein, die sich öffentlich bewusst als „Kapitän“ – und eben nicht als Kapitänin – bezeichnet. Wenn eine Frau etwa als „bester Schriftsteller“ gelten würde, schlösse dies im Gegensatz zur „besten Schriftstellerin“ auch die männlichen Berufskollegen mit ein und würde einen Vergleich nach Leistung statt nach Geschlecht ermöglichen.
Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft zu einer gemeinsamen Sprache zurückfinden und mit dem generischen Maskulinum jenes bewährte Mittel zur Inklusion nutzen, das wir im Deutschen bereits haben. Zumindest stellt die von einer breiten Mehrheit abgelehnte, alltagsuntaugliche und elitäre Gendersprache keine praktikable Alternative hierzu dar.


4 Kommentare
FELIX STEINKE
5. August 2022 - 21:10Gute Replik, die ich uneingeschränkt teile.
Tilo
12. August 2022 - 10:48Ich finde es eine spannende Debatte.
In der Replik sehe ich einige wichtige, richtige und absolut berechtigte Argumente in der Diskussion ums Gendern.
Allerdings sehe ich auch einige Punkte in der Replik kritisch und möchte diese hinterfragen:
(1) Ich finde es schade und sehe es als einen Indikator für eine gewissen Voreingenommenheit des Autors, dass er als Gründe „woraus das Gendern in bestimmten Milieus seine große Attraktivität gewinnt“ nur solche drei benennt, die mit sozialem Druck zu tun haben bzw. aus diesem entstehen – und nicht als Grund benennt, dass jemand gendernd kann, aus bestem Wollen und Überzeugung, mit gegenderter Sprache etwas zu tun, das gesellschaftlich etwas „Gutes“ bewirkt, also aus freiem Willen.
(2) In der Replik steht: „So stellt sich durchaus die Frage, mit welcher Legitimation „der Staat“ und die öffentlich-rechtlichen Medien den Bürgern dennoch immer häufiger gendernd gegenübertreten.“ – Soweit ich das beobachtet habe bzw. als bisheriges Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Thema, würde ich sagen, dass es momentan so ist, dass einerseits, jedes Ministerium, jedes Amt, so ziemlich jede Partei und jede Fraktion und jede/-r einzelne Abgeordnete selbst und andererseits auch jede öffentlich-rechtliche Medienanstalt und in diesen wiederum auch jede Redaktion und zum Teil auch jede/-r Redakteur/-in für sich selbst entscheiden kann und entscheidet, ob und wie er/sie Gendern anwenden will. Darum würde ich als Antwort auf den zitierten Satz antworten, dass es sich bei Leitfäden, erstens, meisten ums freiwillige Gender-Empfehlungen handelt und, zweitens, dass dieses Genderns (und auch nicht-Gernders), bspw. in den öffentlich-rechtlichen Medien, in den allermeisten Fällen ebenso ein Ausdruck freiwilligen Anwendens und nicht-Anwendens ist, wie es sich auch sonst in der Gesellschaft wiederfindet.
Der Satz „Und in der Tat erinnert diese beharrlich „von oben“ geführte Diskussion mitsamt ihrer paternalistischen Anmaßung, mit Hilfe der Sprache über das Denken anderer Menschen bestimmen zu wollen, eher an die Sprachpolitik in der DDR oder an Orwells „Neusprech“ als an eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaft.“ ist meines Erachtens hart überzogen, hoffentlich überspitzt gemeint – und meiner Ansicht nach nicht angemessen. Gerade ein Vergleich mit der DDR ist in diesem Kontext aus meiner Sicht alles andere als angemessen.
(3) „Dass das Gendern seinen Vormarsch zurzeit mehr bürokratischen Verordnungen und Leitfäden als der Einsicht in die besseren Argumente verdankt, müsste eigentlich unabhängig vom Ergebnis jeden nachdenklich stimmen, der für einen ergebnisoffenen gesellschaftlichen Diskurs einsteht.“ – Für diese Behauptung fehlt mir ein Hinweis auf die Evidenz. Das klingt für mich stark nach Bauchgefühl des Autors.
(4) „Wenn eine Frau etwa als „bester Schriftsteller“ gelten würde, schlösse dies im Gegensatz zur „besten Schriftstellerin“ auch die männlichen Berufskollegen mit ein und würde einen Vergleich nach Leistung statt nach Geschlecht ermöglichen.“ – Dieses Argument erschließt sich mir nicht: Warum schlösse „bester Schriftsteller“, nicht aber „beste Schriftstellerin“, Männer mit ein?
Und warum schließt „bester Schriftsteller“ Frauen mit ein?
Zum Abschluss möchte ich loben, dass der Autor seine eigene Emotionalität bei diesem Thema aktiv transparent macht und versucht mit dieser umzugehen. Das finde ich sehr gut. Ich finde, es gelingt an manchen Stellen des Textes nicht. Es macht den Text aber gerade an den Stellen, die ich dafür halte, nachvollziehbarer und für mich empathisch lesbar, bspw. dann, wenn wissenschaftliche Belege für Argumente / Behauptungen fehlen, das Bauchgefühl etwas stärker durchscheint oder etwas überspitzt formuliert wurde.
Viele Grüße
Claudius Kiene
13. August 2022 - 8:47Hallo Tilo,
vielen Dank für Deinen differenzierten und hilfreichen Kommentar, auf den ich gerne antworte:
1.) Dein Einwand ist vollkommen berechtigt – das Gendern aus Überzeugung müsste natürlich Teil einer solchen Aufzählung sein. Ich hoffe, dass in meinem übrigen Beitrag deutlich wurde, dass ich das dahinterstehende Anliegen durchaus anerkenne, nur eben mit der Wahl der Mittel nicht einverstanden bin.
2.) Es mag durchaus so sein, dass die allermeisten Journalisten, die gendern, dies aus voller Überzeugung heraus tun. Wenn etwa ein Medium wie die „taz“ gendert, ist das auch nach meinem Dafürhalten ihr gutes Recht – schließlich muss ich die Zeitung ja nicht kaufen. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien empfinde ich dasselbe jedoch als problematisch. Der ÖRR darf und muss natürlich Veränderungen in unserem Sprachgebrauch nachvollziehen. Er sollte sich aufgrund seines allgemeinen Auftrags und seiner Verpflichtung zur Ausgewogenheit aber nicht zum Schrittmacher eines Sprachwandels machen, den die Mehrheit der Bevölkerung – und damit auch der Beitragszahler – ablehnt. Wenn Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihren Bildungs- als Erziehungsauftrag missverstehen, wie dies jüngst bei einer Sendung des Bayerischen Rundfunks zum Thema Gendern zu beobachten war, ist aus meiner Sicht eine Grenze überschritten.
Nochmal anders gelagert ist für mich der Aspekt des Sprachgebrauchs von Behörden und staatlichen Institutionen. Dass – wie Du richtig schreibst – „jedes Ministerium, jedes Amt […] selbst entscheiden kann und entscheidet, ob und wie er/sie Gendern anwenden will“, halte ich für einen unhaltbaren Zustand. Sprache braucht Verbindlichkeit und zumindest von staatlichen Institutionen sollte ich als Bürger erwarten dürfen, dass sie sich an der Sprachnorm und den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung orientieren.
3.) Ich gebe unumwunden zu, dass in der von Dir zitierten Aussage sicherlich etwas „Bauchgefühl“ drinsteckt und sie einer weiteren Präzisierung bedarf. Zunächst einmal meine ich beobachten zu können, dass 1.) der Anteil derjenigen, die sich in demoskopischen Erhebungen gegenüber dem Gendern ablehnend positionieren, tendenziell eher zu- als abnimmt während sich zugleich 2.) die Gendersprache rasant verbreitet. Du hast natürlich Recht, dass damit keinesfalls gesagt ist, dass die zunehmende Verbreitung nicht auch auf Freiwilligkeit basieren könnte.
Ich würde meine ursprüngliche Aussage daher insofern korrigieren bzw. ergänzen, dass aus meiner Sicht insbesondere die fragwürdige Normsetzung durch gesellschaftlich anerkannte Institutionen wie Bildungseinrichtungen, Behörden und öffentlich-rechtliche Medien eine entscheidende Rolle für den derzeitigen Erfolg der Gendersprache spielt. Wenngleich hier kein unmittelbarer Konformitätsdruck zu beobachten ist, läuft diese Entwicklung doch meinem Verständnis von einem „fairen“ Diskurs (im Sinne einer offenen Suche nach den besseren Argumenten) und von der Rolle, die von der Allgemeinheit finanzierte Institutionen in diesem einnehmen sollten, zuwider.
4.) Da es im Deutschen kein generisches Femininum gibt, können „die besten Schriftstellerinnen“ nie mehr als die Summe aller weiblichen Schriftsteller sein. Unter „den besten Schriftstellern“ wiederum kann die Gesamtheit aller männlichen, weiblichen und diversen Schriftsteller verstanden werden. Mir schwebt hier das Beispiel der britischen Feministinnen vor, durch deren Engagement die „Actress“ heute im Gegensatz zum „Actor“ als eine abwertende Bezeichnung gilt, da sie das Geschlecht und nicht die schauspielerische Leistung akzentuiert. Ich empfehle zu diesem Aspekt folgenden Beitrag der Schriftstellerin Nele Pollatschek im „Tagesspiegel“: https://www.tagesspiegel.de/kultur/deutschland-ist-besessen-von-genitalien-gendern-macht-die-diskriminierung-nur-noch-schlimmer/26140402.html
Ich hoffe meine Antworten konnten mehr Fragen klären als neue aufwerfen!
Weber
7. April 2023 - 13:50Es gibt einen groben Logikfehler in der immer wieder von Gegnern des Genderns angeführten Argumentation, „Sie gehört zu den besten Schriftstellerinnen.“ zu schreiben schmälere die Leistung der Schriftstellerin im Gegensatz zu „Sie gehört zu den besten Schriftstellern.“
Und zwar, dass „Sie gehört zu den besten Schriftstellerinnen.“ ganz einfach gar nicht das geschlechtergerechte Pendant zu „Sie gehört zu den besten Schriftstellern.“ ist. Das Pendant ist: „Sie gehört zu den besten Schriftstellerinnen und Schriftstellern.“ Oder vielleicht auch „Sie gehört zu den besten Literaturschaffenden“. Schließlich geht es beim Gendern doch nicht darum, stumpf und ohne zu überlegen alle männlichen Formen durch weibliche zu ersetzen (dann würde natürlich ein Aspekt fehlen), sondern alle vorher nur „Mitgemeinten“ auch explizit zu nennen (ohne die anderen wiederum nicht zu nennen).